Schulung für Notfälle und Krisen
Facility Management: Empfangs- und Kontaktzentrum » Strategie » Sicherheitsanforderungen » Schulung
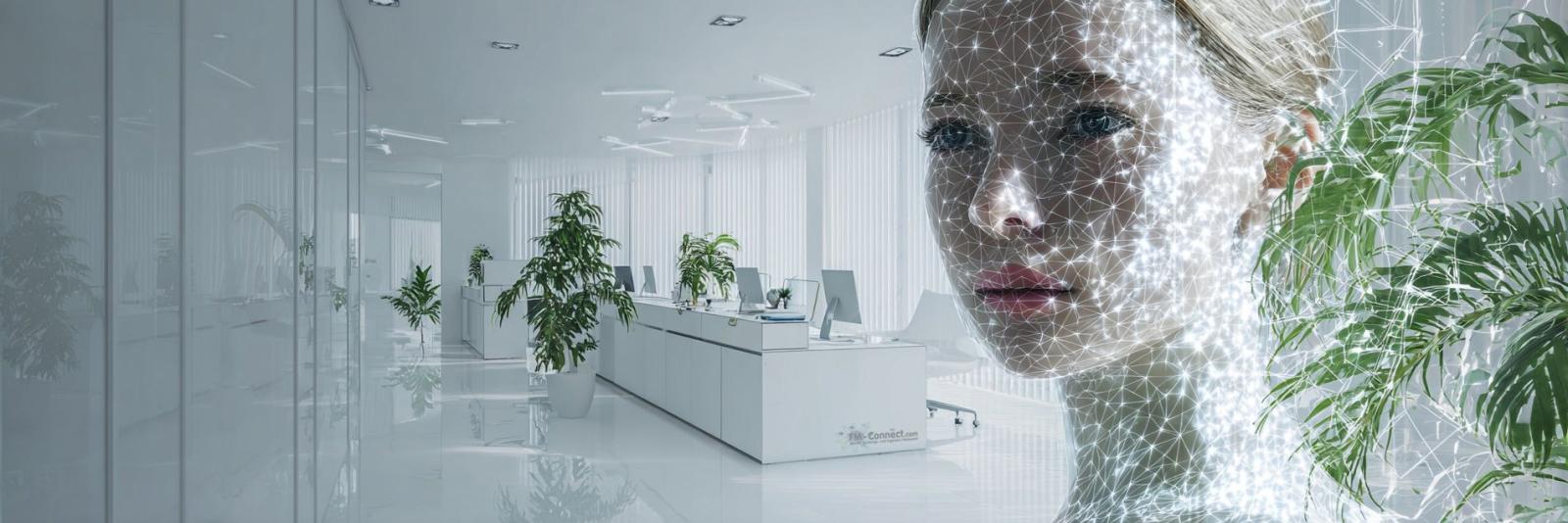
Notfall- und Krisentraining für Empfangspersonal
Empfangsmitarbeiter stehen in vorderster Reihe und übernehmen bei Zwischenfällen die Erstreaktion: Sie lösen Alarme aus, leiten Evakuierungen ein, alarmieren externe Hilfskräfte und koordinieren Kommunikationsflüsse, während sich die Krise entfaltet. Diese zentrale Rolle am Empfang ist mit besonderen Risiken verbunden, da hier ein hoher Besucherandrang herrscht und zugleich Sicherheitsaufgaben wahrgenommen werden. Um diese Risiken zu minimieren und gesetzliche Vorgaben einzuhalten, setzen Unternehmen technische Schutzmaßnahmen (z. B. Zutrittskontrollsysteme), organisatorische Vorkehrungen (Notfallpläne, klare Zuständigkeiten, Checklisten) und personenbezogene Maßnahmen (Schulungen, Stressbewältigungs- und Deeskalationstrainings) im Empfangsbereich um. Regelmäßige Unterweisungen des Personals, Notfallübungen sowie Überprüfungen (etwa im Brandschutz oder Datenschutz) stellen sicher, dass die Maßnahmen dauerhaft wirksam bleiben und bei veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Auf diese Weise gewährleistet das Unternehmen nicht nur die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten und Besuchern, sondern erfüllt auch gesetzliche Pflichten und fördert ein positives Image, indem ein professioneller und sicherer Empfangsbereich betrieben wird.
Die Empfangsmitarbeiter müssen in der Lage sein, entschlossen zu handeln, egal ob es sich um einen Feueralarm, einen medizinischen Notfall oder eine Sicherheitsbedrohung handelt. In den Notfallplänen des Unternehmens ist der Empfang häufig als zentraler Meldpunkt definiert – allen Mitarbeitern wird eingeschärft, dass im Ernstfall immer zuerst der Empfang (oder eine benannte Notfall-Kontaktperson) zu informieren ist. So wird sichergestellt, dass eine einzige geschulte Stelle die geeigneten Maßnahmen umgehend einleiten kann. Falls die primäre Kontaktperson nicht erreichbar ist, muss eine geschulte Vertretung bereitstehen, die die ersten Alarmierungsschritte ausführen kann. Tatsächlich fungiert der Empfangsbereich in vielen Gebäuden als “Emergency Control Center” (Einsatzzentrale): Der Empfangstresen (oft in Nähe der Brandmeldezentrale) wird zum Knotenpunkt für Informationsaustausch und Koordination im Notfall. Die Empfangskraft unterbricht sofort den normalen Betrieb und bewahrt Ruhe, sammelt alle wichtigen Informationen und kommuniziert gleichzeitig mit internen Einsatzkräften und externen Notdiensten. Da das Empfangspersonal jederzeit darüber Bescheid weiß, wer sich im Gebäude aufhält und was in der Lobby passiert, ist es in einzigartiger Weise dafür prädestiniert, Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu bemerken und im Evakuierungsfall sämtliche Mitarbeiter und Besucher zu erfassen. Kurz gesagt, Notfallvorsorge beginnt am Empfang. Durch strukturierte Protokolle, praxisnahe Schulungen und Echtzeit-Kommunikationsmittel werden Empfangsmitarbeiter in deutschen Industriezentralen zu unverzichtbaren Ersthelfern, die Menschen und Sachwerte ab dem allerersten Alarm schützen.
Durch ständige Aus- und Weiterbildung – vom Feuerlöscher-Training über Erste-Hilfe-Kurse bis zu Krisensimulationen – bleiben die Empfangskräfte stets auf dem neuesten Stand und verlieren im Ernstfall weder den Kopf noch wertvolle Zeit. Unterstützt werden sie dabei von technischen Hilfsmitteln wie Alarm-Apps und Panikschaltern, die in Sekundenschnelle die Reichweite ihrer Alarmierung vervielfachen. Entscheidend ist auch, dass diese Rolle des Empfangs im Notfall betriebsintern anerkannt ist: Führungskräfte und Kollegen vertrauen darauf, dass der Empfang weiß, was er tut, und folgen seinen Anweisungen im Alarmfall. Umgekehrt weiß der Empfang, dass er Rückendeckung hat, z. B. dass das Krisenteam bereitsteht und die Geschäftsleitung den Notfallplan gutheißt. Der Empfang – oft das “Gesicht” der Firma nach außen – wird so auch zur “Schutzmauer” in kritischen Momenten. Mit professionellem Notfall- und Krisentraining ist diese Mauer stark: Egal ob Brand, medizinischer Ernstfall oder Sicherheitsbedrohung – die Reaktion beginnt sofort und koordiniert am Empfangstresen und hilft, Menschen und Vermögenswerte vom ersten Alarmton an zu schützen.
Empfangsschulung zu Notfällen am Empfang: Klarer Ablauf, gezielte Ersthelfervorbereitung
Entwicklung von Notfallprotokollen
Klare Notfallprotokolle bilden das Grundgerüst einer effektiven Reaktion. In Industriebetrieben werden Schritt-für-Schritt-Verfahren für alle relevanten Gefahrenszenarien entwickelt – von Bränden und Evakuierungen bis hin zu medizinischen Zwischenfällen oder Sicherheitsbedrohungen – und an die spezifischen Gegebenheiten des Standorts angepasst. Am Anfang steht eine gründliche Gefährdungsbeurteilung, um jene Risiken zu identifizieren, die für Mitarbeiter und Anlage das größte Gefahrenpotenzial darstellen. Für jedes identifizierte Szenario werden standardisierte Handlungsanweisungen erstellt, sodass die ersten Maßnahmen unabhängig von der Notfallart weitgehend gleich ablaufen und routiniert umgesetzt werden können. Diese Notfallpläne legen klar fest, wer im Ernstfall was zu tun hat und welche Kommunikationswege zu nutzen sind: Zum Beispiel, wer den Alarm auslöst, wer externe Einsatzkräfte ruft, wer Besucher betreut, etc. Bei der Ausarbeitung der Protokolle ist es entscheidend, die Fachkenntnis der Arbeitssicherheitsfachkräfte, der Werkschutz- bzw. Sicherheitsabteilung und der Facility-Engineering-Teams einzubeziehen, damit die Verfahren mit den technischen Systemen und tatsächlichen Industrierisiken vor Ort übereinstimmen. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Experten – und möglichst auch durch Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter – stellt man sicher, dass die Notfallmaßnahmen praxisnah und akzeptiert sind.
Um die Protokolle benutzerfreundlich zu gestalten, greifen Unternehmen auf visuelle Hilfsmittel und leicht zugängliche Unterlagen am Empfang zurück. Wesentliche Schritte werden etwa in laminierten Kurzanleitungen, Ablaufdiagrammen oder Checklisten dargestellt und in der Nähe des Empfangs deutlich sichtbar angebracht. Viele deutsche Betriebe integrieren ihre Notfallprozeduren zudem in digitale Formate – zum Beispiel als per QR-Code abrufbares Notfallhandbuch oder als Teil des Qualitätsmanagement-Handbuchs im Intranet. Dadurch kann das Empfangspersonal im Ernstfall sofort auf detaillierte Anleitungen zugreifen. Der Notfallplan sollte gut sichtbar im Empfangsbereich aushängen und zusätzlich digital verfügbar sein, sodass im Ernstfall keine Zeit mit dem Suchen nach Anweisungen verloren geht. Übersichtlich gestaltete Notfallmerkblätter oder farbcodierte Checklisten helfen dem Empfangsteam, auch unter Stress alle Schritte in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten.
Ein effektives Mittel, diese Pläne übersichtlich darzustellen, ist eine Notfall-Matrix, welche die ersten wichtigen Aktionen und Benachrichtigungen für jedes Szenario zusammenfasst. Ein Beispiel hierfür:
Notfallprotokoll-Matrix:
| Notfallart | Ersten drei Maßnahmen am Empfang | Wer ist zu alarmieren |
|---|---|---|
| Brandalarm | • Alarmsystem auslösen (falls nicht bereits automatisch) und Evakuierungs-Checkliste greifen. | Feuerwehr über Notruf 112; Intern: Leiter des Krisenteams und Sicherheitsbeauftragter. |
| Medizinischer Notfall | • Internen Ersthelfer bzw. Betriebsarzt über Notfall informieren; AED und Verbandskasten zum Notfallort bringen. | Intern: Fachkraft für Arbeitssicherheit (EHS) und ggf. Betriebsarzt; Extern: Rettungsdienst/Notarzt über 112. |
| Verdächtiges Objekt/ Bombendrohung | • Bereich weiträumig absperren, Objekt nicht berühren; Personen fernhalten und Ruhe bewahren. | Intern: Werkschutzleiter, Mitglieder des Krisenstabs; Extern: Polizei (110) sofort bei konkreter Bombendrohung. |
In Deutschland und der EU gilt 112 als einheitliche Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst, während 110 für polizeiliche Notfälle vorgesehen ist. Empfangspersonal muss diese Nummern und deren Zuständigkeiten genau kennen.
Die beschriebenen Abläufe sollten für das Empfangsteam jederzeit griffbereit und im Idealfall im Gedächtnis verankert sein. Szenarienspezifische Checklisten (für Brand, Bombendrohung, medizinischen Notfall usw.) stellen sicher, dass im Eifer des Gefechts keine wichtigen Punkte übersehen werden. So würde eine Bombendrohungs-Checkliste beispielsweise beinhalten, bei einem telefonischen Hinweis den Anrufer möglichst lange in Gespräch zu halten, wichtige Details (Sprache, Wortwahl, Hintergrundgeräusche) zu notieren und parallel die Evakuierung und Alarmierung der Polizei einzuleiten. Die Ausrichtung an offiziellen Vorgaben ist ebenfalls wichtig – z. B. die Beachtung des Fragen-Schemas “Wer? Wo? Was? Wie viele? Welche Art von Notfall?” beim Absetzen eines Notrufs. Sämtliche Erstmaßnahmen und alle relevanten Telefonnummern (intern wie extern) sollten in einer Notfall-Info-Tafel am Empfang vermerkt sein. In der Praxis wird in Deutschland häufig ein sogenannter Alarm- und Gefahrenabwehrplan erstellt, der als Teil des betrieblichen Sicherheitskonzepts auch am Empfang hinterlegt ist.
Von entscheidender Bedeutung ist, festzulegen, wen das Empfangspersonal bei welchem Szenario alarmieren muss, um eine abgestufte Eskalationskette auszulösen. Die Mitarbeiter am Empfang müssen die Zusammensetzung des internen Notfall- bzw. Krisenteams kennen und wissen, wie sie diese Personen sofort erreichen. Beispielsweise alarmiert der Empfang bei Brand neben der Feuerwehr (112) umgehend den internen Einsatzleiter bzw. das Krisenteam; bei einem medizinischen Notfall wird der betriebliche Ersthelfer/Betriebsarzt und der Rettungsdienst verständigt; bei einer Sicherheitsbedrohung der Werkschutz und ggf. die Polizei. Das Ziel ist, sofort die richtigen Stellen zu mobilisieren. Eine zentrale Empfehlung in deutschen Betrieben lautet, eine zentrale Meldestelle zu definieren (oft Empfang oder Pförtner), die bei jedem Schadensfall informiert wird – damit alle Mitarbeiter sich nur eine Sache merken müssen: Egal was passiert, zuerst den Empfang anrufen. Diese “eine Nummer”-Regelung garantiert, dass die Alarmierung kanalisiert abläuft und von dort aus alle weiteren Maßnahmen veranlasst werden.
Schulung des Empfangspersonals für Notfälle
Die Reaktion der Empfangsmitarbeiter in den ersten Minuten eines Notfalls kann entscheidend sein – deshalb investieren Industrieunternehmen in ein umfassendes Schulungsprogramm, um das Empfangspersonal auf verschiedenste Krisensituationen vorzubereiten. Die Trainingsmodule vermitteln praktische Fertigkeiten, betriebsspezifische Abläufe und kommunikative Fähigkeiten für den Ernstfall.
Die wichtigsten Bestandteile einer solchen Ausbildung für die “Front-Desk-First-Responder” sind:
Brand- und Evakuierungstraining: Empfangsmitarbeiter werden im grundlegenden Brandschutz und in der Evakuierungsanleitung geschult. Sie lernen, Alarm- und Brandmeldeanlagen zu erkennen und zu bedienen, Feuerlöscher richtig einzusetzen sowie Personen sicher über Fluchtwege zu Sammelplätzen zu führen. Praktische Löschübungen (oft an Feuerlöschtrainern) sind wichtig, damit das Personal mit den verschiedenen Löschmitteln (Wasser, Schaum, CO₂ etc.) und Brandklassen umgehen kann. Ebenso werden sie mit der Brandmeldezentrale vertraut gemacht: Sie müssen wissen, wie der Feueralarm manuell ausgelöst wird (sofern nicht automatisch), wie ein Alarm quittiert oder zurückgesetzt wird (nur auf Anweisung der Feuerwehr) und wie das Gebäude beschallt wird. Da der Empfang im Alarmfall häufig als Einsatzzentrale fungiert, müssen die Mitarbeiter verstehen, was die Anzeigen auf dem Brandmeldetableau bedeuten und wie sie mit Stockwerkshelfern oder der Feuerwehr kommunizieren. Schulungsinhalte sind ferner, wann und wie eine Evakuierung angeordnet wird, wer diese Entscheidung trifft und mit welchen Mitteln (z. B. Durchsage über Lautsprecher oder Alarmsirene). Empfangspersonal muss die Lage der Notausgänge und Sammelplätze auswendig kennen, um evakuierte Personen gezielt dorthin zu lotsen und überprüfen zu können, ob alle in Sicherheit sind. Sie verstehen auch, dass sie während einer Evakuierung ggf. die Lobby und angrenzende Bereiche überprüfen, damit niemand zurückbleibt.
Umgang mit Notfallausrüstung: Das Empfangspersonal erhält eine praktische Einweisung in alle Notfallgeräte, die im Ernstfall relevant sind. Dazu gehört die Handhabung von Feuerlöschern (wie oben erwähnt), von Löschdecken (falls vorhanden) und ggf. von Wandhydranten. Besonders wichtig ist die Schulung am Automatisierten Externen Defibrillator (AED) sowie am Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens, die in der Regel in Empfangsnähe angebracht sind. Die Mitarbeiter müssen wissen, wo sich diese Mittel befinden und wie man sie benutzt. Beispielsweise wird geübt, AED-Elektroden anzubringen und den Sprachanweisungen des Geräts zu folgen, Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) durchzuführen, Druckverbände bei starken Blutungen anzulegen oder ein Verbrennungsset anzuwenden, etc. Sollte es im Betrieb Fluchthauben oder Atemschutzmasken für chemische Unfälle geben, werden die Empfangsmitarbeiter auch darin unterwiesen, diese im Notfall an Personen auszuhändigen oder selbst zu nutzen. All diese Geräte nützen nur, wenn das Personal im Umgang damit vertraut ist – daher wird intensiv praktisch geübt.
Alarmierungs- und Kommunikationsmittel: Empfangskräfte werden im Gebrauch der vorhandenen Kommunikations- und Alarmsysteme trainiert. Das umfasst zum Beispiel das Auslösen des stille Alarms/Panikknopfs unter dem Tresen, das Verwenden von Notfall-Festnetztelefonen oder Betriebsfunkgeräten, das Absetzen von Durchsagen über die hausinterne Lautsprecheranlage sowie das Versenden von Massenbenachrichtigungen über entsprechende Krisen-Apps. Ein Beispiel: Wenn ein bewaffneter Täter im Foyer steht, muss der Empfang die Möglichkeit haben, lautlos Hilfe zu rufen – hier kommt der Überfallalarmknopf ins Spiel, der diskret gedrückt werden kann und direkt die Polizei oder einen Sicherheitsdienst alarmiert. Die Mitarbeiter lernen, unter welchen Umständen dieser Knopf zu drücken ist und was danach passiert. Sie üben auch, wie eine Notfall-Durchsage formuliert sein sollte, um beispielsweise im Brandfall zur Evakuierung aufzurufen oder im Fall eines Amoklaufs eine Warnung auszugeben (ggf. in codierter Form). Durch diese Kommunikationsübungen gewinnen sie Sicherheit darin, im Ernstfall einen Alarm auszulösen und gleichzeitig alle Betroffenen verständlich zu informieren.
Erkennung von Sicherheitsbedrohungen und Deeskalation: Angesichts der Sicherheitsfunktion des Empfangs liegt ein Fokus der Schulung auch darauf, Frühwarnzeichen für mögliche Gefahren zu erkennen und angemessen zu reagieren. Die Empfangsmitarbeiter werden dazu angehalten, ein wachsames Auge auf ungewöhnliches Verhalten von Besuchern zu haben (z. B. sichtbare Nervosität, verweigern von Ausweiskontrollen, Versuche unbemerkt Zutritt zu erhalten). Sie erhalten Deeskalationstraining, um mit aufgebrachten oder aggressiven Personen professionell umzugehen – etwa ruhig zu bleiben, klare Grenzen zu setzen und Hilfe zu rufen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. In Rollenspielen wird geübt, wie man einen verärgerten Besucher verbal beruhigt, wann man diskret über einen Code oder Signal den Sicherheitsdienst ruft und wie man sich selbst in Sicherheit bringt, falls eine Lage eskaliert. In deutschen Unternehmen gehört hierzu auch das Vorgehen bei Amok- oder Terrorlagen: Empfangspersonal wird mit dem betrieblichen “Amok-Alarmplan” vertraut gemacht – meist Maßnahmen wie Auslösen eines Lockdowns (Zutrittswege verriegeln), stille Alarmierung der Polizei (110) und Information der Mitarbeiter, sich einzuschließen oder zu verstecken, falls ein gewalttätiger Eindringling im Gebäude ist. Solche Szenarien werden sensibel, aber realistisch durchgespielt, damit der Empfang im Ernstfall nicht paralysiert ist, sondern nach Plan handeln kann.
Erste-Hilfe-Ausbildung: Von großer Bedeutung ist, dass das Empfangspersonal in Erster Hilfe und lebensrettenden Sofortmaßnahmen ausgebildet und zertifiziert ist, einschließlich der Verwendung des Defibrillators. Wie bereits erwähnt, fungieren Empfangsmitarbeiter oftmals als ausgebildete Betriebliche Ersthelfer gemäß DGUV-Vorschriften, und in jedem größeren Unternehmen muss mindestens ein Ersthelfer pro etlicher Mitarbeiter verfügbar sein. Daher stellen Firmen sicher, dass pro Schicht mindestens eine Empfangskraft eine gültige Erste-Hilfe-Schulung absolviert hat. Diese Grundausbildung (9 Unterrichtseinheiten) plus regelmäßige Fortbildungen umfasst das Beurteilen von Verletzten/Erkrankten, das Durchführen von Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW), den Gebrauch eines AED, die Versorgung starker Blutungen, die Behandlung von Schockzuständen u.v.m. Ein Empfangsmitarbeiter, der im Notfall einen Kollegen wiederbeleben oder einen stark blutenden Schnitt schnell versorgen kann, ist ein enormer Gewinn für die Sicherheit aller. Speziell in Industriebetrieben werden auch besondere Szenarien trainiert – etwa Verätzungen (Kenntnis der Augenduschen und Neutralisationsmittel), Stromunfälle (Trennen vom Strom unter Beachtung der eigenen Sicherheit) oder auch typische Verletzungsmuster an Maschinen. Das Empfangspersonal weiß nach der Schulung, welche Sofortmaßnahmen in solchen Fällen angebracht sind. Wichtig ist auch, dass alle Mitarbeiter – insbesondere aber die “Ersthelfer” – regelmäßig üben, damit die Hemmschwelle im Ernstfall niedrig ist. Je vertrauter die Empfangskräfte mit lebensrettenden Handgriffen sind, desto schneller und sicherer greifen sie im Notfall ein.
Schulungen dürfen keinesfalls einmalig bleiben. Sie müssen kontinuierlich aufgefrischt werden, damit die Kenntnisse präsent bleiben und Verfahren immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Laut deutschen Vorschriften müssen betriebliche Ersthelfer mindestens alle 2 Jahre eine Auffrischung absolvieren, wobei viele Unternehmen – gerade in Hochrisikobranchen – jährliche Kurztrainings ansetzen. Auch Brandschutz- und Evakuierungsübungen finden regelmäßig statt (siehe nächstes Kapitel). In einigen Unternehmen werden quartalsweise interne Schulungen oder Drills veranstaltet, die wechselnde Notfallszenarien abdecken (z. B. im Q1 ein Evakuierungsalarm, Q2 eine Tischübung “Bombendrohung”, Q3 ein medizinischer Notfall Drill usw.). Simulationsbasiertes Lernen ist dabei besonders wirkungsvoll: Das Empfangspersonal nimmt an möglichst realistischen Übungen teil, bei denen sie die Protokolle so üben, als wäre es ein echter Notfall. Zum Beispiel könnte eine Verrauchsituation im Empfang mit einer Nebelmaschine simuliert werden, um die Reaktion auf einen Feueralarm zu üben, oder ein Kollege mimt einen Herzinfarkt am Empfang, um Erste-Hilfe-Maßnahmen zu trainieren. Solche Simulationen stärken die Handlungsroutine und das Selbstvertrauen erheblich besser als theoretischer Unterricht. Nach jeder Übung erfolgt eine Nachbesprechung (Debriefing), in der besprochen wird, was gut lief und was optimiert werden kann. Dabei werden z. B. Kennzahlen analysiert: Wie lange hat die Räumung gedauert? Haben alle den Alarm gehört? War die Kommunikation klar? Diese Auswertung fließt dann in Verbesserungen von Protokollen und künftigen Trainings ein.
Ein strukturierter Schulungsplan für Empfangsmitarbeiter könnte folgendermaßen aussehen - Schulungsplan: Notfallkompetenz am Empfang
| Schulungsthema | Rhythmus | Verantwortlicher Trainer |
|---|---|---|
| Brandschutz & Evakuierungsablauf | Alle 6 Monate | Sicherheitsbeauftragter / Brandschutzhelfer-Ausbilder |
| Erste Hilfe Grundausbildung & AED | Jährlich (gesetzlich alle 2 Jahre) | Zertifizierter Ersthelfer-Trainer (BG anerkannter Ausbilder) |
| Krisenkommunikation & Deeskalation | Vierteljährlich | Leiter Unternehmenssicherheit / Werkschutz |
| HLW/AED Praxisübung (Reanimation) | Alle 2 Jahre (mindestens) | Betriebsarzt oder externer Sanitätsausbilder |
| Gefahrstoff-Notfall (falls relevant) | Jährlich | EHS-Manager (Umwelt, Gesundheit, Sicherheit) |
Anmerkung: In Deutschland müssen betriebliche Ersthelfer alle 2 Jahre an einer Fortbildung teilnehmen. Brandschutz- und Evakuierungshelfer sollten ihr Wissen alle 3-5 Jahre auffrischen, wobei viele Unternehmen zwischen diesen Intervallen interne Übungen durchführen. Empfangspersonal übernimmt oft diese Funktionen (Ersthelfer, Brandschutzhelfer), daher deckt ihr Trainingsplan mehrere Kompetenzfelder ab.
Durch die konsequente Einhaltung dieses Schulungsplans bleibt das Empfangsteam stets einsatzbereit. Die Mitarbeiter wissen, wie man “im Notfall richtig handelt” – vom Löschen eines Papierkorbbrands über das Evakuieren von Gästen bis hin zur Wiederbelebung einer Person mit Herzstillstand. Regelmäßiges Training vermittelt nicht nur Fertigkeiten, sondern gibt den Empfangskräften auch die nötige Sicherheit, dass sie im Ernstfall effektiv helfen können – Panik wird so reduziert und wird durch gezieltes Handeln ersetzt.
Koordination mit dem Krisenteam
In jedem Notfall kommt es darauf an, dass der Informationsfluss zwischen dem Ort des Geschehens und den Entscheidungsträgern reibungslos funktioniert. Der Empfang stellt dabei oft das verbindende Element zwischen der operativen Ebene vor Ort und dem unternehmensinternen Krisenstab sowie den externen Einsatzkräften dar. Es gilt deshalb, im Voraus klare Kommunikations- und Meldestrukturen festzulegen, damit die Empfangsmitarbeiter im Ereignisfall genau wissen, wen sie auf welchem Weg informieren müssen und welche Informationen weitergegeben werden sollen.
Zunächst sollte das Unternehmen direkte und möglichst redundante Notfall-Meldewege einrichten, die vom Empfang genutzt werden können. Dies kann z. B. ein spezielles Notfalltelefon (Hotline) sein, eine Sammelrufnummer, bei der mit einem Anruf mehrere Führungskräfte gleichzeitig informiert werden, oder eine Krisenmanagement-App auf dem Rechner des Empfangs. Viele deutsche Firmen setzen auf Notfall-Alarmierungssysteme (Softwares oder Apps), mit denen das Empfangspersonal oder ein anderes autorisiertes Mitglied des Krisenteams per Knopfdruck alle relevanten Stellen alarmieren kann. Beispielsweise könnte in einer solchen App ein Button “Großalarm” hinterlegt sein, der im Ernstfall eine vordefinierte Nachricht an das gesamte Krisenteam sendet (“Feueralarm in Zentrale – Evakuierung läuft, Sammelplatz A”). Empfangsmitarbeiter werden im Umgang mit diesen Systemen geschult – z. B. wie sie über ein Web-Dashboard oder Smartphone in Sekunden eine Notfallbenachrichtigung absetzen können. Parallel sollten Alarmierungsketten in Papierform vorhanden sein: Eine laminierte Eskalationsgrafik am Empfang kann festhalten, wer bei welchem Ereignis in welcher Reihenfolge zu benachrichtigen ist (mit allen Telefon- und Mobilnummern). Zum Beispiel: Bei Stufe Mittel (begrenzter Notfall) zuerst den EHS-Leiter anrufen; bei Stufe Hoch (kritischer Notfall) sofort gesamte Krisenleitung alarmieren und 112 wählen. Durch regelmäßige Übungen verinnerlichen die Empfangskräfte diese Eskalationspläne und können im Ernstfall innerhalb von Sekunden die Alarmierung des Krisenteams einleiten.
Ebenso wichtig ist die klare Definition der Rollen und Erwartungen zwischen Empfang und Krisenteam. In der akuten Phase fungiert der Empfang oft als Informationsdrehscheibe. Während sich das Ereignis entfaltet, leitet er laufend aktuelle Informationen an die Einsatz- bzw. Krisenleiter weiter (die sich entweder in einem Krisenraum zusammenfinden oder telefonisch zugeschaltet sind). Angenommen, es brennt im Gebäude: Nachdem der Empfang das Krisenteam und die Feuerwehr alarmiert hat, erhält er vielleicht von Evakuierungshelfern Rückmeldungen, welche Bereiche geräumt sind – diese gibt er umgehend an den Krisenleiter weiter, z. B. “Alle Etagen evakuiert bis auf das Kellergeschoss, dort warten 2 Personen mit Behinderung auf Hilfe.” In gewisser Weise ist der Empfang die Augen und Ohren des Krisenstabs vor Ort, bis spezialisierte Einsatzkräfte eintreffen. Um dies zu ermöglichen, wird oft eine Einsatzzentrale in der Nähe des Empfangs oder im Pförtnerraum eingerichtet, die mit den nötigen Kommunikationsmitteln (Telefone, Funkgeräte, ggf. Kamera-Monitor) ausgestattet ist. Wie bereits erwähnt, fungiert der Empfangstresen in vielen Gebäuden als solche Einsatzzentrale, wobei die Empfangskraft als zentrale Stelle für den Informationsaustausch agiert – zumindest so lange, bis der offizielle Einsatzleiter das Kommando übernimmt.
Die Mitarbeiter am Empfang sollten ein klares Verständnis für die Schweregrade von Notfällen und die jeweils vorgesehenen Maßnahmen haben. Üblich ist eine Einteilung in z. B. Stufe 1 (geringer Notfall), Stufe 2 (mittlerer Notfall), Stufe 3 (schwerer
Stufe 1 – Geringfügiger Vorfall: Ereignisse mit wenig Gefährdung, die keine unmittelbaren Schäden erwarten lassen (z. B. kleine Verletzung, kurzzeitiger Stromausfall). Der Empfang dokumentiert den Vorfall im Betriebstagebuch oder Meldeformular und informiert einen vorgesetzten Mitarbeiter, etwa den Schichtleiter oder Facility Manager. Der Krisenstab wird nicht einberufen; es handelt sich eher um Routine-Störungen. Externe Hilfskräfte werden nicht alarmiert. Dennoch wird der Vorfall registriert, um ggf. als “Beinaheunfall” ausgewertet zu werden.
Stufe 2 – Begrenzter Notfall: Situationen, die Aufmerksamkeit erfordern, aber (noch) keine Vollalarmierung nötig machen (z. B. Entstehungsbrand, der direkt gelöscht wurde, oder ein Gefahrstoffalarm, der lokal begrenzt und unter Kontrolle ist). Hier wird der Empfang Teile des internen Krisenteams alarmieren – typischerweise die Kernmitglieder wie EHS-Leiter, Werkschutzleiter und Werkleiter. Diese Personen werden entweder zum Ereignisort geschickt oder kommen zur internen Beratung zusammen. Der Empfang nutzt das interne Alarmsystem oder ruft sie einzeln an. Externe Einsatzkräfte werden informiert, aber vielleicht zunächst nur in Bereitschaft gehalten (z. B. kann der Empfang die Feuerwehr über die Nicht-Notrufnummer kontaktieren und die Lage schildern, ohne dass gleich ein kompletter Löschzug anrückt). So ist das Krisenteam in Alarmbereitschaft und überwacht die Situation; steigt die Gefahr, kann jederzeit auf Stufe 3 erhöht werden.
Stufe 3 – Kritischer Notfall: Schwere Notfälle, die Menschenleben oder erhebliche Sachwerte akut bedrohen (z. B. ein ausgedehnter Brand, eine erforderliche Gebäudeevakuierung, ein aktiver Attentäter, Explosion, Großunfall). In diesem Fall greift der volle Notfallplan: Der Empfang ruft sofort die externen Einsatzkräfte über 112 (Feuerwehr/Rettung) bzw. 110 (Polizei, bei Gewaltlagen) und meldet das Ereignis. Parallel werden alle Mitglieder des internen Notfall- und Krisenstabs alarmiert (Vollalarm), z. B. durch eine Sammelalarmierung per App oder Telefonkaskade. Zudem wird umgehend eine Anweisung an alle Personen im Gebäude gegeben (ggf. durch Auslösen des Räumungsalarms oder Durchsage über Lautsprecher, bzw. bei Amoklage: Durchsagen oder andere Warnsignale für Lockdown). Der Empfang initiiert also alle notwendigen Erstmaßnahmen, einschließlich einer vollständigen Evakuierung oder Sicherung des Gebäudes gemäß Protokoll. Anschließend konzentriert sich das Empfangspersonal darauf, die eintreffenden Einsatzkräfte einzuweisen und laufend Status-Updates an den Krisenstab und die Behörden zu geben.
Diese gestuften Abläufe lassen sich in einer Krisen-Kontaktmatrix veranschaulichen - Krisenkontakt-Protokoll:
| Notfall-Stufe | Aktion des Empfangs | Intern zu alarmieren | Externe Partner |
|---|---|---|---|
| Niedrig (Stufe 1) | Vorfall aufnehmen und dokumentieren; ggf. unmittelbaren Vorgesetzten informieren.Situation beobachten, falls Verschlechterung eintritt. | Intern: z. B. Facility Manager oder EHS-Verantwortlicher. | Kein externer Alarm (intern bewältigbar, Informationen fließen nur intern). |
| Mittel (Stufe 2) | Alarm an zentrales Krisenteam (Kernmitglieder) auslösen – per Telefon oder Alarm-App; Lage schildern und Rückmeldung abwarten.Evtl. vorsorgliche Warnung an Mitarbeiter in betroffenen Bereich (ohne Gesamtevakuierung). | Intern: Ausgewählte Krisenstabsmitglieder (Einsatzleitung, Sicherheitsverantwortliche, Werksarzt etc.). | Ggf. externe Stellen vorwarnen: z. B. betriebsärztlichen Dienst oder Feuerwehr über interne Nummer informieren, aber noch keine Großalarmierung. |
| Hoch (Stufe 3) | 112 (und falls nötig 110) sofort anrufen, Notfall melden mit allen Details.Gesamten Krisenstab alarmieren; Hausalarm/Durchsage zur Evakuierung oder zum Lockdown absetzen.Alle per Checkliste vorgesehenen Sofortmaßnahmen durchführen (Evakuierung einleiten, Notausgänge öffnen, etc.). | Intern: Komplettes Notfall- und Krisenteam (alle relevanten Abteilungen, Geschäftsführung informiert). | Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei – je nach Notfall über die Notrufnummern alarmiert. Zusätzlich ggf. externe Sicherheitsleitstelle (wenn Unternehmen angeschlossen). |
Sobald der Krisenstab intern gesammelt hat, bleibt der Empfang in der Rolle der Schnittstelle. Er muss darauf vorbereitet sein, kritische Informationen zu übergeben: Beispielsweise sollte am Empfang eine Mappe mit den wichtigsten Notfalldokumenten bereitliegen – Gebäudeplan, Liste gefährlicher Stoffe, Liste mobilitätseingeschränkter Personen – um sie bei Eintreffen der Feuerwehr sofort auszuhändigen. Es ist gute Praxis, dass Kopien solcher Unterlagen in der Einsatzzentrale (Empfang/Pförtner) hinterlegt sind und vom Empfangspersonal auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Das Empfangspersonal sollte zudem wissen, wo sich Sammelstellen befinden und wer dort den Überblick hat, damit es Rückmeldungen von dort (z. B. “Alle Mitarbeiter sind am Sammelplatz versammelt”) an den Krisenstab weitergeben kann.
Während eines laufenden Notfalls kann die Lage chaotisch sein – der Empfang muss mit einer Flut von Anfragen umgehen: Anrufe von Mitarbeitern, Rückfragen des Krisenteams, Alarmmeldungen von Anlagen. Hier zahlt sich Schulung aus: Ruhe bewahren, Prioritäten setzen und systematisch arbeiten. Lebenswichtige Meldungen (etwa ein Notruf an 112 oder die Durchsage an alle) gehen vor; erst danach wird weniger Dringliches bearbeitet. Eine wichtige Regel ist: keine parallelen Aufgaben anfangen, die die Hauptaufgabe gefährden. Beispielsweise soll das Empfangspersonal keine Besucher abfertigen oder Telefonzentrale-Aufgaben erledigen, während ein Notfall läuft – “während Alarm oder Notfall haben alle anderen Tätigkeiten zu stoppen”. Dieses Prinzip muss auch vom Management unterstützt werden, damit im Ernstfall die Konzentration voll auf dem Notfallmanagement liegt.
Ein weiterer Aspekt ist die Planung der externen Koordination beim Eintreffen der Hilfskräfte. Häufig treffen Feuerwehr oder Rettungsdienst am Haupteingang bzw. Empfang ein. Empfangsmitarbeiter sollten darauf vorbereitet sein, sie schnell einzuweisen: Wo ist der Einsatzort? Wer wird vermisst? Welche besonderen Gefahren (Chemikalien, Gasflaschen) gibt es? – All dies wurde idealerweise in der Vorplanung mit der örtlichen Feuerwehr besprochen. Viele Betriebe führen gemeinsam mit den lokalen Einsatzkräften Begehungen oder Übungen durch, damit z. B. die Feuerwehr das Objekt kennt und weiß, dass der Empfang als erster Anlaufpunkt fungiert. Das Empfangspersonal sollte außerdem Schlüssel, Zugangsmedien und relevante Dokumente bereithalten. In manchen Notfallplänen ist vorgesehen, dass ein Mitarbeiter vom Empfang die Feuerwehr vor dem Gebäude empfängt und direkt zum Brandort geleitet (dazu tragen solche Mitarbeiter manchmal auffällige Westen mit Aufschrift “Einweiser”). In der Hektik einer Evakuierung darf dieser Punkt nicht vergessen werden – entsprechend wird er geübt und in Checklisten verankert.
Zusammengefasst besteht die Aufgabe des Empfangs im Krisenfall darin, die Reaktion einzuleiten und dann als Bindeglied zwischen Ort des Geschehens, dem internen Krisenteam und den externen Einsatzkräften zu fungieren, bis die Lage unter Kontrolle ist. Durch klare Koordinationsprotokolle wird sichergestellt, dass nichts und niemand “durchrutscht”: Jeder Mitarbeiter weiß, dass er auf dem kurzen Dienstweg dem Empfang meldet, was passiert ist, und der Empfang leitet die standardisierten Maßnahmen ein. Oder in den Worten einer deutschen Sicherheitsfachzeitschrift: Bestimmen Sie eine zentrale Stelle (oft den Empfang), die bei jedem Notfall informiert wird – Vorteil: “Alle Mitarbeiter müssen sich erst mal nur merken: Egal was passiert, ich rufe beim Empfang an.”. Alles Weitere nimmt dann seinen geregelten Lauf.
Brand- und Evakuierungsübungen
Pläne allein reichen nicht – durch regelmäßige Übungen wird die Notfallbereitschaft aller, insbesondere auch des Empfangs, auf die Probe gestellt und kontinuierlich verbessert. In deutschen Industriezentralen werden daher in festgelegten Abständen verschiedene Notfallszenarien geübt.
Der Empfang hat dabei vor, während und nach der Übung spezielle Aufgaben:
Häufigkeit und Arten von Übungen: Mindestens einmal pro Jahr sollte eine Evakuierungsübung (Feueralarmübung) durchgeführt werden – in vielen Fällen ist dies durch die Feuerwehr oder Unfallversicherungsträger vorgeschrieben oder empfohlen. Größere Unternehmen gehen oft darüber hinaus und planen zwei Übungen jährlich oder zusätzliche Teilübungen, um unterschiedliche Schichten und neue Mitarbeiter abzudecken. Der Empfang ist in jede Übung eingebunden – häufig wird die Übung sogar am Empfang ausgelöst, um das Personal dort realitätsnah zu testen. Zum Beispiel könnte unangekündigt der Feueralarm aktiviert werden, und es wird beobachtet, ob das Empfangspersonal gemäß Protokoll reagiert: Alarmweiterleitung, Notruf absetzen, Durchsage machen, etc. Besonders unangesagte Übungen sind wertvoll, weil sie den Ernstfall simulieren und zeigen, ob die Reaktionszeiten stimmen und ob wirklich alle alarmiert werden. Mit der Zeit entwickeln die Mitarbeiter am Empfang so eine Routine, die im echten Notfall abrufbar ist. Es hat sich bewährt, Übungsszenarien zu variieren – mal wird angenommen, der Hauptausgang ist durch Feuer blockiert (dann muss der Empfang die Besucher zu einem anderen Ausgang führen), mal wird ein internat. Gast simuliert, der kein Deutsch spricht (der Empfang muss auf Englisch anleiten). So bereitet man sich auf diverse Eventualitäten vor.
Rolle des Empfangs während der Übung: Sobald der (Probe-)Alarm ertönt, folgen für das Empfangsteam definierte Schritte. Typischerweise fungiert es als Evakuierungshelfer für den Eingangsbereich. Das bedeutet, alle Besucher und betriebsfremden Personen, die sich im Empfangs- oder Wartebereich befinden, aktiv zur Räumung anzuhalten und sie auf dem sichersten Weg ins Freie zu geleiten. Besucher kennen die Fluchtwege nicht, daher muss das Empfangspersonal hier Führungsfunktion übernehmen – im Idealfall begleitet es Besuchergruppen bis zum Sammelplatz. Außerdem muss der Empfang eine aktuelle Besucherliste zur Hand haben (ob in Papierform vom Besuchsregister oder elektronisch vom Besuchermanagement-System) und diese unbedingt mit zum Sammelplatz nehmen. Dort kann sie abgeglichen werden, um sicherzustellen, dass auch alle Besucher das Gebäude verlassen haben. Moderne digitale Systeme bieten dem Empfang beispielsweise eine Evakuierungsliste in Echtzeit über die Cloud, die per Smartphone abrufbar ist. Auf diese Weise lassen sich Gäste ebenso wie Mitarbeiter verlässlich in die Zählung einbeziehen. Dies ist nicht nur Sorgfaltspflicht gegenüber den Gästen, sondern verhindert auch, dass Rettungskräfte unnötige Risiken eingehen müssen, um nach vermissten Personen zu suchen, die tatsächlich schon draußen sind.
Das Empfangspersonal hilft während der Übung auch bei der Vollzähligkeitskontrolle am Sammelplatz mit, soweit es nicht andere kritische Aufgaben hat. In der Praxis meldet jeder Evakuierungshelfer oder Bereichsverantwortliche dem Sammelplatzkoordinator (manchmal ist das der Sicherheitsbeauftragte oder Gebäude-Evakuierungsleiter) die Anzahl der evakuierten und ggf. vermissten Personen. Der Empfang kann hier unterstützend wirken, indem er die Besucherzählung liefert und eventuell Listenmaterial bereitstellt. Falls Personen vermisst gemeldet werden, kann der Empfang in seinen Unterlagen prüfen, ob diese vielleicht als Besucher ausgetragen wurden oder das Gelände bereits vorher verlassen hatten – solche Informationen können eine Suche abkürzen. Wichtig: Der Empfang sollte niemals eigenmächtig ins Gebäude zurücklaufen, um Nachschau zu halten, solange keine Freigabe der Feuerwehr vorliegt; in Übungen wird stattdessen geprobt, die Info wer fehlt sofort an die Einsatzleitung weiterzugeben.
Innerhalb des Gebäudes kann es vorkommen, dass das Empfangs- oder Sicherheítspersonal zusätzliche Pflichten übernimmt, z. B. die Kontrolle der Erdgeschossbereiche (Toiletten neben der Lobby, Nebenräume), um sicherzustellen, dass wirklich niemand zurückbleibt. In manchen Notfallplänen ist vorgesehen, dass der letzte am Empfang verbliebene Mitarbeiter nach Alarmierung noch kurz checkt, ob angrenzende Räume frei sind, bevor er selbst das Gebäude verlässt – selbstverständlich nur, falls dies ohne Eigengefährdung möglich ist. In Übungen wird dies erprobt, um zu sehen, ob es praktikabel ist und ob dabei kein Zeitverlust entsteht.
Ein weiterer Punkt: Häufig obliegt es dem Empfang oder Werkschutz, nach erfolgter Räumung den Eingang abzusichern, damit niemand vor Freigabe wieder eintritt. Das Empfangspersonal kann angewiesen sein, direkt nach Verlassen des Gebäudes den Zutritt zu blockieren (z. B. Eingangstüren zu schließen oder dort zu postieren). In Übungen wird auch dies geübt und beobachtet – etwa, ob Mitarbeiter versucht haben, zurück ins Gebäude zu laufen (um etwas zu holen), und wie das Empfangspersonal reagiert hat. Hier gilt es in der Nachbesprechung, das Bewusstsein zu schärfen, dass ein Wiedereintritt erst nach ausdrücklicher Entwarnung durch Einsatzleiter erfolgen darf.
Besondere Belange – Personen mit Einschränkungen: Der Empfang sollte eine aktuelle Liste aller Mitarbeiter oder regelmäßigen Besucher mit Mobilitätseinschränkungen bzw. besonderem Unterstützungsbedarf griffbereit haben (oft in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung und dem Sicherheitsingenieur erstellt). Während Übungen wird der Ablauf für diese Personen ebenfalls getestet: Sind Evakuierungshelfer für sie eingeteilt? Wurden diese Helfer alarmiert und haben ihre Aufgabe erfüllt? Beispielsweise, wenn ein Besucher im Rollstuhl in der Eingangshalle ist, muss das Empfangspersonal wissen, wie laut Plan vorzugehen ist – etwa die Person mit Hilfe eines Kollegen in einen sicheren Bereich (Feuertreppenhaus) zu bringen und der Feuerwehr dessen Standort mitzuteilen. In vielen Gebäuden führen die Evakuierungshelfer eine Liste der Personen, die Hilfe brauchen, und geben diese Info an den Einsatzleiter weiter. Empfangsmitarbeiter sollten mit diesem Prozess vertraut sein und während der Übung proaktiv nachfragen, ob alle hilfsbedürftigen Personen betreut wurden. Die verantwortlichen Helfer (zwei pro Person werden empfohlen) melden dem Empfang bzw. Sammelplatz dann, wenn sie ihren Schützling in Sicherheit gebracht haben. Indem solche Abläufe in Übungen durchgespielt werden, stellt man sicher, dass im Ernstfall niemand vergessen wird und die Zusammenarbeit zwischen Empfang, Evakuierungshelfern und Feuerwehr reibungslos klappt.
Nachbereitung und Protokollierung: Nach jeder Übung findet idealerweise eine Auswertung statt. Das Empfangspersonal sollte aktiv in die Nachbesprechung eingebunden werden, denn es hat einen einzigartigen Überblick über den Ablauf (es sieht, wann Alarm war, wann die ersten raus kamen, ob Panik entstand, etc.). In dieser Runde kann das Empfangsteam Feedback geben: Haben die Alarmierungsanlagen funktioniert? War die Verständigung klar? Wusste jeder Mitarbeiter am Empfang, was zu tun ist? Gab es Probleme z. B. mit dem Besuchermanagement? All diese Punkte sind Gold wert, um die Prozesse zu verbessern. Übungsbeobachter und Sicherheitsbeauftragte werten die Übung meist nach festgelegten Kriterien aus – z. B. Dauer der Evakuierung, etwaige Mängel (versperrte Fluchtwege, verwirrte Besucher, defekte Sirene etc.). Der Empfang sollte seine Aspekte dazu beitragen: beispielsweise vermerken, dass der Telefonalarm an den Krisenstab 1 Minute gedauert hat oder dass es Unklarheit gab, wer die Feuerwehr einweist. In Deutschland ist es üblich, ein Übungsprotokoll zu erstellen, in dem alle wichtigen Daten festgehalten werden (Datum, Uhrzeit, Teilnehmerzahl, besondere Vorkommnisse). Das Empfangspersonal kann beauftragt sein, den Abschnitt zu schreiben, der seine eigenen Handlungen beschreibt, oder zumindest dem Sicherheitsverantwortlichen eine schriftliche Rückmeldung zu geben. Wenn Fehler passiert sind (z. B. Notruf nicht abgesetzt, weil fälschlich angenommen wurde, ein anderer hätte es getan), werden diese offen angesprochen und zum Anlass genommen, die Zuständigkeiten nachzuschärfen.
Durch solche Übungen “mit Lerneffekt” verbessert sich die Notfallorganisation stetig. Das Empfangspersonal gewinnt an Routine, die Unsicherheit sinkt. Bei einem echten Alarm wissen alle Beteiligten am Empfang: Das haben wir geübt, wir kennen unseren Ablauf. Mitarbeiter folgen den Anweisungen eher diszipliniert, wenn sie diese aus Übungen schon kennen. Empfangsmitarbeiter wiederum entwickeln ein Gefühl von Verantwortung und Kompetenz. Und wie eine Quelle betont: Notfallpläne helfen nur, wenn die Mitarbeiter sie auch verinnerlicht haben – was nur durch praktisches Üben erreicht wird. Der Empfang nimmt hierbei eine Schlüsselrolle ein.
Vorgehen bei medizinischen Notfällen
Nicht jeder Notfall ist ein Brand oder eine externe Gefahr – häufig treten akute medizinische Zwischenfälle in den Vordergrund. Ein Herzinfarkt, eine schwere Verletzung oder ein anaphylaktischer Schock kann jederzeit und überall passieren, auch in der Unternehmenszentrale. Daher werden Empfangsmitarbeiter in deutschen Industrieunternehmen darauf vorbereitet, bei medizinischen Notfällen schnell und richtig zu reagieren, bis der Rettungsdienst eintrifft.
Im Folgenden wird dargestellt, wie sich der Empfang auf solche Situationen vorbereitet und welche Schritte er unternimmt:
Ausstattung im Empfangsbereich: Es ist üblich, dass wichtige Erste-Hilfe-Mittel in unmittelbarer Nähe des Empfangs platziert sind. Dazu zählen ein gut gefüllter Erste-Hilfe-Kasten (Verbandkasten nach DIN 13157/13169) und oftmals ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED), der in einem Wandkasten in Lobbynähe hängt. AEDs sollten an Orten positioniert werden, die leicht zugänglich und schnell zu erreichen sind – häufig also in der Eingangshalle oder Lobby –, sodass im Notfall innerhalb von 3 Minuten ein Schock abgegeben werden könnte. Der Standort ist durch grüne Hinweisschilder gekennzeichnet und allen Mitarbeitern bekannt. Das Empfangspersonal überprüft in vielen Fällen regelmäßig diese Ausrüstung (z. B. wöchentliches Kontrollieren der AED-Statusanzeige, Haltbarkeitsdaten von Verbandsmaterialien usw.), teils gemeinsam mit dem Sicherheitsbeauftragten. Durch die Platzierung eines AED am Empfang – einer zentralen Stelle – kann entweder ein Helfer das Gerät sehr schnell holen oder die Empfangskraft es selbst zum Notfallort bringen. Auch ein Direktwahl-Notruftelefon (mit gespeicherter 112-Verbindung) kann im Empfangsbereich vorgesehen sein, um im Ernstfall keine Nummer wählen zu müssen.
Grundausbildung Lebensrettende Sofortmaßnahmen: Wie schon erwähnt, sind Empfangsmitarbeiter oft Teil der betrieblichen Ersthelfer. Bei einem medizinischen Notfall könnten sie somit die Erstversorgung übernehmen, noch bevor die Rettungsprofis eintreffen. In ihrer Ausbildung haben sie den Ablauf der Ersten Hilfe verinnerlicht: Bewusstsein prüfen, Hilfe rufen, Atmung kontrollieren, Notruf absetzen, dann Herzdruckmassage und Beatmung im Wechsel beginnen, falls keine normale Atmung vorhanden ist, und so schnell wie möglich den AED einsetzen. Bei stark blutenden Wunden wissen sie, dass sie sich selbst schützen (Handschuhe tragen) und dann einen Druckverband anlegen bzw. mit direktem Druck die Blutung stillen müssen, die Person flach lagern und Schockzeichen beobachten, während der Notruf bereits läuft. Bei Bewusstlosigkeit aber erhaltener Atmung bringen sie die Person in die stabile Seitenlage und kontrollieren weiterhin Atmung und Puls. Wenn jemand einen Krampfanfall (epileptischen Anfall) hat, sorgen sie dafür, dass sich die Person nicht verletzen kann (gefährliche Gegenstände entfernen, etwas Weiches unter den Kopf legen) und warten ab, ohne etwas in den Mund zu stecken – nach dem Anfall sichern sie die Atemwege. Diese und viele weitere Maßnahmen – z. B. bei Herzinfarkt (Lagerung mit erhöhtem Oberkörper, enge Kleidung öffnen), bei Verätzungen (Augenspülung), Verbrennungen (Kühlen) – werden in den Erste-Hilfe-Kursen trainiert und idealerweise regelmäßig geübt. Ganz wesentlich: Die Empfangsmitarbeiter kennen die Standorte spezieller Hilfsmittel wie Notduschen oder Augenduschen in ihrer Nähe und wissen diese zu bedienen. Zudem kennen sie die zuständigen betrieblichen Ansprechpersonen, z. B. gibt es in manchen Firmen einen Betriebsarzt oder Sanitäter vor Ort, den der Empfang bei einem medizinischen Notfall parallel informieren kann.
Ablaufschema bei medizinischen Vorfällen: Ein klar definiertes Vorgehen hilft dem Empfang, keine Zeit zu verlieren. Beispielsweise beim Verdacht auf Herz-Kreislauf-Stillstand (Bewusstlosigkeit, keine Atmung): Protokoll besagt, dass sofort der Notruf 112 abgesetzt wird, dann unmittelbar mit der CPR (Herzdruckmassage) begonnen wird und parallel der AED herbeigeschafft und eingesetzt wird. Möglichst ruft eine zweite Person die 112, während die erste mit der Reanimation startet. Ein anderes Beispiel: Starke arterielle Blutung (z. B. Kreissägenunfall in der Werkstatt, verletzte Person kommt blutend zur Pforte): Der Empfang zieht Schutzhandschuhe an, lässt die Person sich hinlegen, drückt mit sterilen Kompressen kräftig auf die Wunde, legt dann einen festen Druckverband an oder benutzt ein Abbindesystem (Tourniquet) oberhalb der Wunde, falls verfügbar und notwendig. Gleichzeitig ruft (bzw. ein Kollege ruft) 112 und der Empfang nennt art und Schwere der Verletzung. Wichtig ist hier die Priorität: starke Blutungen können in wenigen Minuten lebensbedrohlich sein, daher hat das Stoppen der Blutung absolute Priorität, sogar noch vor dem Notruf – ideal ist Arbeitsteilung, damit beides gleichzeitig passiert. Ein weiteres Szenario: Bewusstlos am Empfang zusammengebrochen (z. B. Schlaganfall oder Zuckerschock). Der Empfang prüft Bewusstsein und Atmung. Ist die Person bewusstlos, aber atmet, folgt die stabile Seitenlage, regelmäßige Kontrolle, gleichzeitig 112 rufen und angeben, dass Person bewusstlos ist, aber atmet. Ist keine normale Atmung feststellbar, gilt sie als Kreislaufstillstand: Dann HLW und AED wie oben. Ist es “nur” eine Ohnmacht und die Person kommt nach kurzer Zeit wieder zu sich, bleibt der Empfang dennoch aufmerksam, lagert evtl. die Beine hoch und lässt vom Betriebsarzt checken. – Solche Protokolle sind oft in Erste-Hilfe-Aushängen formuliert, die im Betrieb aushängen (auch der Empfang kann eine kleine Übersicht am Platz haben). Das Empfangspersonal sollte diese Abläufe gut kennen, um in der Hitze des Gefechts gar nicht viel nachdenken zu müssen.
Wichtig ist auch die Interaktion mit dem externen Rettungsdienst nach dem Absetzen des Notrufs. Die Leitstelle der 112 wird dem Anrufer (also dem Empfang) Fragen stellen und ggf. Anweisungen geben – hier gilt es, ruhig zu bleiben und klar zu antworten: Wo genau (Adresse, Gebäude) ist der Notfall? Was ist geschehen (Unfall, Erkrankung)? Wie viele Betroffene? Welche Art von Verletzungen/Symptomen? und Warten auf Rückfragen. Dieses bekannte Schema (5-W-Fragen) beherrscht das Empfangspersonal idealerweise. Die Notrufdisponenten können telefonische Anleitungen geben (z. B. zur Reanimation), die der Empfang dann befolgt oder an andere Helfer vor Ort weitergibt. Aufgelegt wird erst, wenn die Leitstelle das Gespräch freigibt – manchmal möchten sie dranbleiben, bis die Rettung eintrifft, um weiter beraten zu können. Der Empfang sollte außerdem sicherstellen, dass nach dem Telefonat die Leitung frei bleibt, falls Rückruf erfolgt oder weitere Koordination nötig ist. In der Zwischenzeit kann er Mitarbeiter beauftragen, z. B. “Empfang an alle per Funk: Der Rettungsdienst ist gerufen, ein Mitarbeiter bitte vor dem Gebäude auf die RTW warten und einweisen.”
Unterstützung der Rettungskräfte: Sobald der Rettungsdienst oder Notarzt eintrifft, unterstützt der Empfang nach Kräften. In einem großen Werksgelände kann dies bedeuten, dass ein Fahrzeug vom Werksschutz sie vom Tor abholt. In einem Verwaltungsgebäude mit Empfang wird meist ein Mitarbeiter – vielleicht der Empfangskollege – an der Tür warten, winken und den Sanitätern den direkten Weg zum Patienten zeigen. Zeit ist hier wieder der Schlüsselfaktor. Der Empfang kann auch helfen, Aufzüge für die Retter freizuhalten oder Türen zu öffnen. Falls spezielle Umstände vorliegen (z. B. Zugang mit Schlüsselkarte nötig, oder Gefahrstoff bei Unfall im Spiel), muss der Empfang diese Infos sofort weitergeben. Von Bedeutung ist auch, den Profis zu berichten, was bereits getan wurde: “Wir haben einen Schock mit dem AED abgegeben”, “Der Patient hat 5 Minuten HLW bekommen, dann kam er zu Bewusstsein” oder “Die Blutung wurde mit einem Tourniquet gestoppt.” Diese Informationen, vom Empfang oder Ersthelfer übergeben, helfen dem Rettungsdienst, die Behandlung nahtlos zu übernehmen. Ebenfalls sollte jegliche bekannte medizinische Vorgeschichte oder Allergien des Betroffenen erwähnt werden, sofern dem Empfang solche Informationen vorliegen (oft nicht der Fall, aber bei Stammgästen oder Kollegen manchmal bekannt: “Er ist Diabetiker” etc.).
Nach dem Vorfall: Ist der Notfall beendet und der Patient versorgt bzw. abtransportiert, übernimmt der Empfang noch Aufgaben in der Nachbereitung. Beispielsweise muss ein Unfallbericht für die Berufsgenossenschaft ausgefüllt werden, insbesondere wenn es ein Arbeitsunfall war. Der Empfang, der als erster vor Ort war, trägt dann seine Beobachtungen und Maßnahmen dort ein. Auch muss das benutzte Erste-Hilfe-Material wieder aufgefüllt werden: Der Verbandkasten wird überprüft und verbrauchte Artikel ersetzt; bei Nutzung des AED werden eventuell die Elektroden erneuert, und das Gerät wird auf Fehler geprüft. Ein betriebliches Meldebuch (Verbandbuch) wird aktualisiert mit dem Vorfall. Zusätzlich sollte eine interne Nachbesprechung stattfinden (z. B. im Sicherheitskreis oder mit dem Betriebsarzt): Was lief gut, wo gab es Probleme? Wenn z. B. festgestellt wird, dass die AED-Bedienung Schwierigkeiten machte, wird das zum Anlass genommen, eine außerplanmäßige Übung anzusetzen. Oder wenn der Notfallort schwer zu finden war für die Rettung (z. B. weil keine klare Beschilderung), veranlasst der Sicherheitsbeauftragte Verbesserungen. Solche Learnings sind wichtig. Und nicht zuletzt: Ein schwerer medizinischer Notfall kann auch für Helfer belastend sein – daher bieten manche Unternehmen den betroffenen Kollegen (inkl. Empfangspersonal) ein Gespräch oder debriefing mit dem Betriebsarzt oder einem Notfallpsychologen an, um das Erlebte zu verarbeiten (Stichwort “psychosoziale Unterstützung nach belastenden Einsätzen”).
Durch einen klar geregelten und geübten Ablauf bei medizinischen Notfällen und die Ausstattung mit AED & Co. stellt die Firma sicher, dass selbst in diesen oft unerwarteten Situationen schnell gehandelt wird. Die ersten Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes gehören dem betriebsinternen Ersthelfer-Team – und da der Empfang oft am nächsten dran ist, übernimmt er diese Aufgabe. Im Idealfall wird das Zusammenwirken von Empfang und Rettungskräften so reibungslos, dass die “therapiefreie Zeit” minimiert wird und die Chancen der Betroffenen deutlich steigen. Ein gut vorbereitetes Empfangsteam kann somit Leben retten oder schwere Folgen verhindern, was letztlich unbezahlbar ist.
Überblick: Medizinisches Notfallprotokoll für den Empfang: (als kurze Orientierung)
| Situation | Erste Schritte des Empfangs | Hilfsmittel/Kontakte |
|---|---|---|
| Herz-Kreislauf-Stillstand (Bewusstlosigkeit, keine Atmung) | Maßnahmen: 112 rufen (Notfallmeldung: Person bewusstlos, atmet nicht). Unverzüglich HLW beginnen (30x drücken, 2x beatmen abwechselnd). AED holen lassen oder selbst holen und anschließen – Sprachanweisungen befolgen. Solange weitermachen, bis Rettungsdienst übernimmt.Zusätzlich: Kollegen bitten, Eingänge für Rettung zu öffnen und einzuweisen. | AED-Gerät (Defibrillator); Beatmungsmaske (sofern vorhanden) aus Erste-Hilfe-Kasten; evtl. zusätzlicher Helfer (für Wechsel bei HLW). Betriebsarzt informieren (falls im Hause). |
| Schwere Blutung (starke Blutung, Amputation) | Maßnahmen: Handschuhe anziehen (Selbstschutz). Verletzten hinlegen lassen. Direkt mit sauberer Kompresse auf die Wunde drücken, extremen Druck ausüben. Falls möglich verletztes Körperteil hochlagern. 112 rufen (Unfall mit starker Blutung melden).Nachlegen: Blutet es durch, weitere Tücher draufpressen (nicht den ersten Verband entfernen). Falls vorhanden und nötig, Druckpunkt abdrücken oder Tourniquet (Abbindesystem) oberhalb der Wunde straff anlegen.Betroffenen beruhigen und warmhalten bis Hilfe eintrifft. | Ersthelfer-Koffer (Druckverband-Päckchen, sterile Tücher, Dreieckstuch/Tourniquet); Einmalhandschuhe; Telefon/Handy (für Notruf und Kommunikation mit Rettungskräften). Ggf. interner Notfallplan für Amputationsverletzungen (Kühlbox für abgetrenntes Gliedmaß etc.). |
| Bewusstlosigkeit (z. B. Ohnmacht, Schlaganfall) | Maßnahmen: Bewusstsein prüfen (ansprechen, Schmerzreiz). Atmung kontrollieren:- Wenn Atmung vorhanden: stabile Seitenlage herstellen, Atemwege freimachen. 112 rufen (Person bewusstlos, atmet) und laufend Atmung prüfen. Bei Erbrechen, Atemstillstand oder Verschlechterung entsprechend reagieren (Absaugbereitschaft, CPR falls nötig).- Wenn keine normale Atmung: als Herzstillstand behandeln -> siehe oben (HLW + AED, Notruf).Bei Krampfanfall: nicht festhalten, Umgebung sichern. Nach Anfall Person in Seitenlage bringen. | Erste-Hilfe-Kasten (Beatmungshilfen, Decke, ggf. Absauggerät falls vorhanden für Betriebsarzt); AED bereithalten (falls Zustand sich verschlechtert); Telefon für Rücksprache mit Rettungsleitstelle. Intern: Werksarzt / Sanitäter informieren, falls vorhanden. |
Natürlich ist jeder medizinische Notfall anders – das Empfangspersonal muss flexibel reagieren. Doch dank eines strukturierten Protokolls (das die wichtigsten Schritte vorgibt) und regelmäßiger Übung dieser Handgriffe können Empfangsmitarbeiter auch in stressigen Situationen kühlen Kopf bewahren und das Richtige tun. So wird wertvolle Zeit überbrückt, bis professionelle Hilfe vor Ort ist, und der Gesundheits- bzw. Überlebensstatus der Betroffenen entscheidend verbessert.
Echtzeit-Krisenkommunikationstools
In einer Notsituation zählt jede Sekunde – daher braucht das Empfangspersonal Zugang zu Kommunikationsmitteln, die es erlauben, augenblicklich Alarm zu schlagen und Informationen zu verbreiten. Moderne Technologien unterstützen dies, doch es müssen auch Ausfallsicherheiten vorhanden sein.
Im Folgenden werden die wichtigsten Tools und Systeme beschrieben, die in deutschen Industriezentralen am Empfang eingesetzt werden, um im Krisenfall eine schnelle und zuverlässige Kommunikation sicherzustellen:
Digitale Alarmierungs- und Warn-Apps: Viele Unternehmen haben heute Massenbenachrichtigungssysteme oder Krisenmanagement-Apps im Einsatz, über die der Empfang oder das Krisenteam im Ernstfall alle Mitarbeiter oder definierte Gruppen gleichzeitig alarmieren kann. Ein Klick genügt und alle bekommen eine SMS, E-Mail oder Push-Nachricht mit vorformuliertem Warntext. Beispiel: Über eine App wird die Nachricht “Achtung: Feuer im Gebäude A, bitte sofort über Notausgänge zum Sammelplatz X evakuieren” an alle Beschäftigten geschickt. Solche Apps protokollieren auch, wer die Nachricht erhalten/gelesen hat und erlauben teils eine Rückmeldung (Mitarbeiter können z. B. “bin in Sicherheit” klicken). Empfangsmitarbeiter haben in der Regel auf ihrem PC oder dienstlichen Handy Zugriff auf diese Software und werden darin geschult, wie man im Notfall eine Alarmierung auslöst. Der Vorteil solcher Systeme ist die enorme Geschwindigkeit und Reichweite – auch Personen, die gerade nicht im Gebäude sind (Außendienstler, Home-Office, etc.), werden informiert. Als Redundanz hält man oft eine SMS-Verteilerliste bereit: Sollte die spezielle App nicht funktionieren, kann der Empfang über ein Firmenhandy eine vorbereitete Sammel-SMS an alle verschicken. Und sollte auch das scheitern, gibt es immer noch die altbewährte Telefonbenachrichtigungskette, bei der der Empfang den ersten anruft, dieser den nächsten usw. – alles natürlich im Voraus geplant.
Stiller Alarm (“Panikknopf”): Unter dem Empfangstresen ist in sicherheitskritischen Einrichtungen fast immer ein Überfall- bzw. Panikalarmknopf installiert. Dieser ermöglicht es dem Empfangspersonal, bei Raub, Geiselnahme oder Amoklage Hilfe zu rufen, ohne den Täter aufmerksam zu machen. Der Knopf ist verdeckt montiert (leicht mit der Hand oder dem Fuß/Knie zu drücken) und mit der Alarmanlage oder einem externen Wachdienst/Polizei verbunden. Wird er betätigt, gibt es unterschiedliche Szenarien: Häufig wird direkt ein Alarm an eine Notruf- und Serviceleitstelle oder an die Polizei übermittelt, die umgehend Einsatzkräfte schickt. Alternativ kann das Signal auch intern gehen, z. B. an den Werkschutz, der dann per Kamera nachschaut oder telefonisch beim Empfang “durchklingelt”. Manche Systeme sehen ein codiertes Rückrufformat vor (die Leitstelle ruft an; wenn der Empfang z. B. mit einem festgelegten Satz antwortet, wissen beide Seiten: Alarm war echt; ein anderes Codewort bedeutet Entwarnung). Wichtig ist: Der covert panic alarm sollte so gestaltet sein, dass der Täter nichts davon merkt – also keine Sirene oder blinkendes Licht im Empfangsbereich selbst, da dies die Empfangsperson gefährden würde. Stattdessen reagiert das System verdeckt: z. B. ein stiller Alarm nur im Sicherheitsbüro oder ein Blinken in einem entfernten Lager, woraufhin dort gemäß Prozedur gehandelt wird. Der Panikknopf muss – wie andere Systeme auch – regelmäßig getestet werden, oft wöchentlich, und zwar dokumentiert, v. a. wenn bestimmte Sicherheitsstandards (wie TAPA FSR im Logistikbereich) erfüllt werden sollen. Empfangsmitarbeiter werden trainiert, unter welchen Umständen sie den stillen Alarm auslösen sollen (z. B. bei Androhung von Gewalt) und was danach zu tun ist (möglichst Beschreibung des Täters merken, unauffällig anderen ein Zeichen geben, sich selbst in Sicherheit bringen, etc.). Dieses kleine unscheinbare Gerät kann im Ernstfall Leben retten – daher wird es mit hoher Priorität behandelt. Ein Notfallplan enthält idealerweise auch Alternativen, falls der Panikknopf defekt ist: Beispielsweise einen Code über Telefon, den der Empfang an die Polizei oder eine interne Stelle geben kann. Ein klassisches Beispiel ist ein verabredeter Satz wie “Können Sie Frau Müller schicken?” am Telefon, was bedeutet, dass Polizei benötigt wird. Solche Codes sollten vorab trainiert sein.
Gebäude-Durchsage- und Alarmsysteme: Meist verfügt der Empfang über die Kontrolle des Durchsage-Systems (PA) bzw. der Gebäudealarmierung. Im Notfall kann die Empfangskraft oder der Sicherheitsdienst eine Durchsage an alle auslösen: “Achtung, dies ist ein Notfall – bitte verlassen Sie geordnet das Gebäude über die Treppen und begeben Sie sich zum Sammelplatz!” (bei Feuer) oder “Achtung, sichern Sie sich in Ihrem Raum, verlassen Sie nicht das Gebäude!” (bei Amok/Attentat). Moderne Sprachalarmanlagen haben vorgespeicherte Ansagen, die automatisch ablaufen, wenn ein Alarm aktiviert wird. Nichtsdestotrotz muss das Personal in der Lage sein, per Mikrofon eigene Ansagen zu machen, falls nötig. Dafür werden im Vorfeld Durchsatztexte formuliert und geübt, damit im Ernstfall keine Panik durch falsche Wortwahl ausgelöst wird. Man vermeidet z. B. Wörter wie “Panik” oder “Bombendrohung” in öffentlichen Durchsagen, sondern verwendet z. B. Codes (“Technischer Defekt – verlassen Sie das Gebäude”). Der Umgang mit dem PA-System gehört also zur Notfallausrüstung des Empfangs. Darüber hinaus hat das Empfangspersonal oft Zugriff auf die Feueralarmzentrale – dort darf es z. B. nach Rücksprache mit der Feuerwehr den Alarm abstellen oder zurücksetzen, jedoch nur wenn die Feuerwehr das Okay gibt (Feuerwehr-Anlaufregel: Ein Alarm wird erst nach Freigabe zurückgestellt). Auch diese Bedienung wird geübt, damit es im realen Fall keine Fehlbedienung gibt. Im Zweifel gilt: Der Empfang lässt den Alarm laufen, bis offizielle Entwarnung erfolgt, auch wenn es ein Fehlalarm war – so die Vorgabe, um keine Verwirrung zu stiften. Technische Alarmmittel können unterschiedlich sein – Sirenen, Hupen, Durchsagen – der Empfang lernt alle kennen und weiß, wie man z. B. manuell einen Feueralarm auslöst (durch Drücken des Handfeuermelders) oder wie man eine Sirene im ganzen Gebäude aktiviert, falls das automatische System ausfällt.
Betriebsfunk und Notfall-Funksysteme: In vielen Industrieunternehmen sind Handfunkgeräte im Einsatz, v. a. zwischen Sicherheitskräften, Werkfeuerwehr und manchmal auch zwischen Krisenteam-Mitgliedern. Der Empfang sollte mindestens ein Funkgerät besitzen, das auf dem Notfallkanal sendet. So kann er im Alarmfall direkt mit den Evakuierungshelfern, Stockwerksbeauftragten oder dem Krisenleiter kommunizieren, ohne auf Telefon angewiesen zu sein. Diese Direktkommunikation ist gerade bei Strom- oder Telefonausfall unschätzbar – Funkgeräte arbeiten autark über Akku. So kann z. B. der Empfang durchgeben: “Alarm wurde ausgelöst, alle bitte evakuieren” und später: “Empfang an alle: Gebäude komplett geräumt, Treffpunkt Sammelplatz West, niemand darf zurück rein.”. Funkdisziplin (kurze klare Funksprüche, Meldung wenn alle draußen sind etc.) wird ebenfalls geübt. Sollte die Anlage groß sein und der Funk nicht überall reicht, können mehrere Relaisstationen vorhanden sein – der Empfang kennt die Funkzonen. Als Backup sollte zusätzlich mindestens ein leistungsfähiges Megafon verfügbar sein: Falls z. B. das elektrische Durchsagesystem ausfällt, kann der Empfang oder der Evakuierungsleiter mit dem Megafon am Sammelplatz bzw. durch die Gänge (sofern gefahrlos betretbar) Anweisungen geben. Auch Lautsprecherwagen (bei sehr großen Arealen) oder Sirenen sind mögliche Zusatzmittel. Der Empfang hält auch Kontakt zu externen Einsatzkräften per Funk, falls diese über Betriebsfunk mit dem Krisenstab reden möchten (manche Feuerwehren geben dem Betrieb auf Wunsch ein Funkhandgerät auf dem Einsatzstellenkanal – das ist aber eher bei großen Chemiestandorten üblich). Ansonsten beschränkt sich der Empfang darauf, intern per Funk und extern per Telefon zu kommunizieren.
Gebäudeleittechnik-Integration: Moderne Hauptverwaltungen verfügen oft über eine Gebäudeleittechnik (GLT) oder Building Management System (BMS), die Alarme, Klimaanlagen, Zutritte, Videoüberwachung etc. zentral überwacht. Häufig ist diese Leitstelle in der Sicherheitszentrale angesiedelt, aber manchmal hat auch der Empfang Einblick oder zumindest eine Anzeigetafel. Im Notfall können solche Systeme wertvolle Informationen liefern: z. B. welche Brandmelder ausgelöst haben (Anzeige “Rauchmelder Lagerraum 2”), ob Sprinkler aktiviert sind, wie der Status der Lüftungsanlagen ist (bei Rauchabsaugung) etc. Das Empfangspersonal kann diese Daten sofort dem eingetroffenen Einsatzleiter mitteilen, was Zeit spart. Ebenso können Videoüberwachungsmonitore am Empfang helfen, sich ein Bild zu machen – etwa wo im Gebäude noch Personen zu sehen sind oder ob wirklich alle Fluchtwege frei sind. In Gefahrensituationen wie einem bewaffneten Täter wäre es extrem hilfreich, den Standort und die Bewegung des Täters über Kameras zu verfolgen; sofern rechtlich zulässig und technisch vorhanden, könnte der Empfang diese Info an die Polizei weitergeben. Allerdings ist zu beachten, dass Empfangsmitarbeiter in einer Stresslage nicht zu viel parallel machen sollten – primär steht die Alarmierung und Betreuung an. Die GLT kann zusätzliche Helfer des Krisenteams übernehmen, falls vorhanden. Der Empfang sollte aber Zugriff darauf haben oder zumindest schnell jemanden erreichen, der es bedient, falls wichtige Daten gebraucht werden.
Notstrom und Backup-Kommunikation: Alle Kommunikations- und Alarmsysteme nützen wenig, wenn bei einem Stromausfall der Empfang im Dunkeln sitzt und nichts mehr geht. Deshalb verfügen sicherheitsbewusste Betriebe über Notstromaggregate oder USV-Anlagen, die zumindest die kritischen Komponenten am Laufen halten: Alarmanlage, Notbeleuchtung, Telefonanlage oder zumindest ein Nottelefon, Feuerwehrlaufkarten-Beleuchtung etc. Empfangsmitarbeiter sollten wissen, welche Geräte am Empfang notstromversorgt sind. Beispielsweise sind manche Telefonanlagen bei Stromausfall tot, aber es kann einen analogen Notfallapparat geben, der direkt am Amt angeschlossen ist. So einen Telefonhörer (oft rot markiert) sollte der Empfang griffbereit haben und dessen Bedienung kennen. Ebenso könnten zusätzliche Hilfsmittel bereitliegen: ein batteriebetriebenes Radio (um bei großflächigen Katastrophen behördliche Durchsagen zu empfangen) und ein satellitengestütztes Telefon (SatPhone) als ultimative Reserve, falls Mobilfunk und Festnetz ausgefallen sind – dies ist aber eher in Konzernen oder Hochsicherheitsbereichen üblich. Jedenfalls muss man sich auch auf Worst-Case-Situationen vorbereiten: Was, wenn bei einem Anschlag oder Blackout gar nichts Elektrisches mehr geht? Hier sind Manuelle Alternativen wichtig: z. B. ein Luftdrucksignalhorn oder Handglocke, um Alarm zu schlagen; bereits angesprochene Megafone; Fahrräder oder zu Fuß laufende Boten, um Nachrichten zum Sammelplatz oder Nachbargebäude zu tragen. Solche Szenarien klingen drastisch, aber das Durchspielen im Rahmen von Notfallplanung schärft das Bewusstsein und verhindert, dass man völlig hilflos ist, wenn High-Tech einmal versagt.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Kommunikationskanäle und Backups - Kommunikationsmittel & Ausweichoptionen:
| Mittel/Kanal | Einsatz im Notfall | Backup bei Ausfall |
|---|---|---|
| Massenalarm-System (App/SMS) | Schnelle Benachrichtigung aller Mitarbeiter oder definierter Gruppen per Klick (Evakuierungsalarm, Warnmeldungen). Meist Zwei-Wege-Kommunikation (Rückmeldungen/Ack-Funktionen). | Falls App/Internet ausfällt: Standard-SMS-Verteiler über Mobiltelefon; in letzter Instanz manuelle Telefonanruf-Ketten (jede Führungskraft ruft ihr Team an). |
| Panik-/Überfallknopf | Lautloser Hilferuf an Polizei/Sicherheitsdienst bei Überfall, Amok oder ähnlichen Bedrohungen. Löst umgehend Interventionsmaßnahmen aus, ohne Täter zu alarmieren. | Codewort am Telefon als verdeckter Hilferuf (z. B. bestimmter Satz beim Anruf des Sicherheitsleiters/der Polizei bedeutet “sofort kommen, aber verdeckt”). Alternativ: tragbarer Funksender (Panikknopf am Körper) für Empfangsmitarbeiter, falls stationärer Knopf nicht erreichbar. |
| Durchsageanlage (PA) | Gebäudeweite Sprachdurchsagen für Evakuierung oder Anweisungen (z. B. Sammelplatz nennen, Entwarnung geben). Automatische Alarmtexte bei Feuer, manuelle Ansagen bei Bedarf. | Megafon als Ersatz für Durchsagen, falls PA-System ausfällt. Zusätzlich: interner Messenger (z. B. am PC) um schriftliche Hinweise an alle Bildschirme zu senden, falls keine Lautsprecher verfügbar (sofern System dafür vorhanden). |
| Betriebsfunkgeräte (Walkie-Talkie) | Direkte Kommunikation mit Evakuierungshelfern, Sicherheitsdienst und Krisenstab vor Ort. Funktioniert unabhängig von Telefonnetz, ideal bei Koordination während Räumung. | Handy-Telefonkonferenz als Ersatz, falls Funk ausfällt/nicht vorhanden. Ggf. WhatsApp-Gruppe als textbasierte Notfallkommunikation. Ansonsten physische Melder (Läufer), die Informationen überbringen. |
| Videoüberwachung & BMS | Liefert visuelles Lagebild (wo brennt es, wo befindet sich der Täter), Infos über Gebäudetechnik (aktivierte Melder, Lüfterstatus). Empfang kann diese Infos an Feuerwehr/Krisenstab weiterleiten. | Physische Erkundung durch interne Kräfte (z. B. Sicherungsposten schickt jemanden, um nachzusehen, falls Kameras ausfallen). Bei defekter Gebäudeleittechnik: direkter Augenschein, manuelles Zählen von Leuten am Sammelplatz statt digitaler Liste. |
| Notstrom/Notfallstrom | Hält wesentliche Kommunikationsmittel am Laufen (Notbeleuchtung, Alarmanlage, ggf. Nottelefon oder Funk) bei Stromausfall. Empfang hat dadurch weiterhin Mittel zur Kommunikation. | Batteriebetriebene Hilfsmittel: z. B. analoges Telefon (am Amtsanschluss, ohne Strom); tragbares UKW-Radio (für Behördeninformationen von Außen); Handlampen für Sichtsignale. Falls alle Stricke reißen: persönliche Mobiltelefone (auch diese ggf. laden mit Powerbank). |
Empfangsmitarbeiter müssen nicht nur diese Werkzeuge kennen, sondern auch wissen, wann welches Backup zu verwenden ist. Daher werden in Trainings auch Ausfallszenarien behandelt – etwa: “Stellen Sie sich vor, der Feueralarm geht los, aber die Durchsageanlage funktioniert nicht – was tun Sie?” So lernt das Personal, in solchen Fällen z. B. sofort das Megafon zu schnappen und selbst zu rufen oder per Funk die Evakuierungshelfer zu bitten, in ihren Bereichen Laut zu alarmieren.
Ein weiteres wesentliches Element ist das Testen der Systeme. Der Panikknopf wurde bereits erwähnt (wöchentliche Funktionsprüfung mit Protokoll). Auch die Massenalarm-Software sollte regelmäßig mit einem Probealarm getestet werden (etwa quartalsweise ein Test-Alarm an alle, mit Hinweis “Dies ist eine Übung”). Die PA-Anlage wird evtl. monatlich oder quartalsweise per kurzer Testdurchsage gecheckt (“Test der Lautsprecher, bitte ignorieren”). Das Empfangspersonal spielt bei solchen Tests mit, entweder als Auslösender oder zumindest als Überwacher (es meldet z. B. an den Sicherheitsbeauftragten zurück: “Durchsage war in der Lobby laut und klar verständlich”). Durch dieses Testing werden auch Bedienfehler im Vorhinein erkannt und behoben.
Schließlich ist auf Datenschutz und Datensicherheit bei diesen Tools zu achten – wer darf sie auslösen, wie wird Missbrauch verhindert? Normalerweise hat nur befugtes Personal (Empfang, Sicherheitszentrale, Krisenstab) Zugriff auf Alarm-Apps und Überfallalarme. Dies ist im Sicherheitskonzept festgelegt. Empfangsmitarbeiter tragen eine große Verantwortung, erhalten aber auch das Vertrauen und die Befugnis, im Notfall ohne Rückfrage Alarm schlagen zu dürfen. Das gesamte Unternehmen muss dahinter stehen, damit keine Verzögerung eintritt (z. B. kein Vorgesetzten-Anruf nötig, bevor 112 angerufen wird – das wäre fatal). Entsprechend wird in Schulungen klar kommuniziert: Safety first – im Zweifel lieber einmal zu oft Alarm schlagen als zu spät.
Durch die Ausstattung des Empfangs mit modernen, robusten Kommunikationstools sowie durchdachten Backup-Lösungen stellen deutsche Industrieunternehmen sicher, dass bei einem Notfall vom Empfang aus unverzüglich und wirksam alarmiert und kommuniziert werden kann. Ob per Knopfdruck Hunderte von Menschen informiert werden oder still und leise die Polizei gerufen wird – der Empfang verfügt über die Mittel, um aus einer lokalen Gefahr eine geordnete Reaktion zu machen. Technik und Training gehen hier Hand in Hand: Die beste App nützt nichts ohne geschulte Hände, die sie bedienen – und umgekehrt kann ein kompetenter Mitarbeiter ohne Mittel wenig ausrichten. Deshalb wird in der Notfallorganisation der Empfang als zentraler Knotenpunkt betrachtet und entsprechend ausgerüstet.
